Dinge im Alltag, die dir nicht auffallen
Tut es dir auch weh, präsent zu sein? + Eine Aufgabe + Alltagspoesie #1


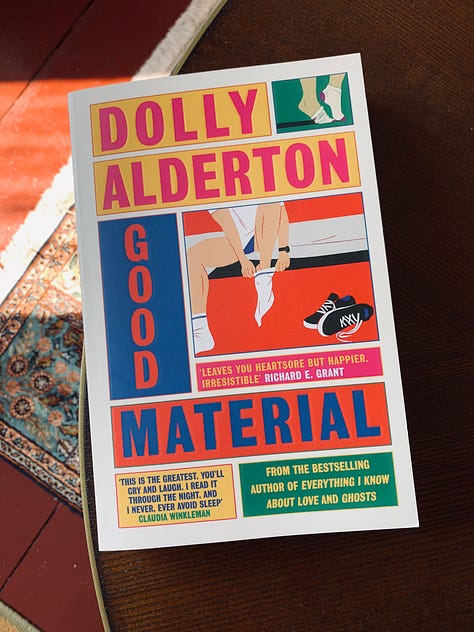





Er traf mich mit voller Wucht, dieser Satz: Es tut weh, präsent zu sein.
Ich runzelte die Stirn, bereit, mich wie ein schmollendes Kind dagegen zu wehren. Ist präsent sein nicht das, wonach wir alle in dieser Welt voller Ablenkungen streben? Warum wünschen wir uns etwas, das angeblich weh tut? Ich saß ein paar Minuten grübelnd in Stille, ließ den anfänglichen Schock nachlassen, und musste irgendwann resignieren. Ja. Ja, das tut es.
Die Aussage stammt von einer meiner Lieblingsdichterinnen Marie Howe, die Poesie an der New Yorker Universität Sarah Lawrence unterrichtet. Sie erzählt in einem Interview mit der Journalistin Krista Tippett davon, dass sie ihren Studierenden am Anfang des Jahres eine Aufgabe gibt, die für die meisten eine Herausforderung darstellt. Die Übung besteht darin, jede Woche zehn Beobachtungen aus ihrer Umgebung aufzuschreiben und dabei auf Abstraktionen, Interpretationen, Bewertungen und Vergleiche zu verzichten.
Howe macht ein Beispiel: Ich sah ein Wasserglas auf einem braunen Tischtuch, und das Licht schien an drei Stellen hindurch.
Sie schreibt nicht darüber, woran sie bei diesem Anblick erinnert wird oder was das Gesehene in ihr auslöst. Sie beschreibt nur, was vor ihr ist. Klingt einfach? Ist es aber nicht.
In den ersten Wochen finden die Studierenden nichts wichtig oder spannend genug, das es wert wäre, notiert zu werden. Sie fühlen sich genervt, wollen abbrechen und konzentrieren sich darauf, was sie denken, anstatt was sie sehen. Sie schmücken ihre Beobachtungen mit Metaphern aus und halten „interessante“, zum Nachdenken anregende Aussagen fest, die sie in Gesprächen aufschnappen. Die Momentaufnahmen für sich werden also als ungenügend bewertet und immer in Relation zu etwas gebracht.
Ich denke darüber nach, wie oft wir uns im Verhältnis zu etwas anderem sehen: Wir definieren uns durch unsere Beziehungen, kulturelle und religiöse Zugehörigkeit, politische Einstellung, unsere Rollen in der Gesellschaft und im Beruf, etc. Unsere Identität klammert oft unhinterfragt an Attributen, die uns im Laufe der Jahre zugeschrieben wurden und/oder die wir uns selbst angeeignet haben. Manchmal fühlt es gut und erdend an, ein Teil von etwas zu sein. Und manchmal realisieren wir, dass wir loslassen müssen. Der Akt des Beobachtens kann auch bedeuten, sich bewusst die Zeit zu nehmen, all diese Schichten abzulegen und sich zu fragen: Wer bin ich wirklich? Kein Wunder, dass sich niemand auf dieses Terrain begeben will. Es tut weh!
Ich wage mich an die Aufgabe heran und schreibe den ersten Satz auf. Ich scheitere sofort.
Ich möchte sagen: Ich schmiere Marillenmarmelade [danke Inge!] aufs Brot und es hört sich an, als würde jemand neben mir leise eine Banane essen.
Das ist bloß der Anfang. Kaum ist eine Sekunde vergangen, schon taucht eine neue Assoziation auf. Ich erinnere mich an den Tag diese Woche, als ich mittags Burrata aufs Olivenbrot strich und daran, wie der Käse sich vorher in der Hand so leicht und verletzlich anfühlte, als würde jeden Moment die cremige Flüssigkeit aus ihm herausplatzen. Dann dachte ich an den Sizilienaufenthalt vor ein paar Jahren und an das Häuschen im Landesinneren, das einen breiten Holztisch auf der Terrasse hatte.
Ich bemerke also etwas und ziehe im nächsten Moment meine Aufmerksamkeit davon ab. Bin ich von der Belanglosigkeit des Moments so gelangweilt, dass mein Gehirn automatisch nach einer spannenderen Story sucht? Womöglich. Wir sind darauf trainiert, in allem einen Sinn zu sehen, sodass das Gefühl, etwas Einfaches wahrzunehmen, dessen Zweck nicht sofort ersichtlich ist, fast unerträglich erscheint.
Ich übe, achtsam zu beobachten. Ich lerne das Verlernen. Ich aktiviere alle meine Sinne, akzeptiere alle aufkommenden Verluste und Sackgassen, stelle mich der emotionalen Dissonanz zwischen dem, was ist und dem, was ich mir vielleicht stattdessen wünsche. Ich versuche, den Geist ruhigzustellen und Klarheit zu schaffen. Anstatt vorbeizugehen, bleibe ich stehen und schaue zu.
Zuerst, ein Neubeginn: Ich schmiere Marillenmarmelade aufs Brot, breche die Stücke der Frucht mit dem Messer auf.
Und dann:
Links: das leise Wiegen der sonnengetrunkenen Lindenäste, unten: die Abdrücke des Kissens auf meinen Fingern. Eine Stunde später sind sie verschwunden.
Die Blätter (mit prominenten Blattadern) des Avocadobaums wachsen in eine Richtung, sie strecken sich zum Fenster, zum Licht.
Die Mischung der Geräusche: das Brummen meines Bauchs, das Dröhnen der Autos auf der Straße, das Geschrei der Kinder, das Bellen der Hunde.
Die Welt ist voller Einzelgänger: Ein Buch, das allein und verlassen zwischen den U-Bahn-Gleisen liegt. Ein halbgeschmolzenes Fruchteis am Stiel mitten auf der Straße. Der einzige bunte Stein unter vielen, der so aussieht, als würde er im Sonnenlicht leuchten. Ein Schuh, der am Ufer zwischen zwei Ästen steckt.
Der Aufkleber auf dem knallorangenen Mülleimer sagt mir, dass er mich liebt.
Bunt bemalte Töpfe ohne Blumen entlang der Kurve des Rundbalkons in der Hufelandstraße.
Das Klatschen der (riesigen!) Rucksäcke gegen die Rücken zweier Schulmädchen.
Dunkle Flecken auf dem Bürgersteig und auf den Händen der älteren Frau, die mit geschlossenen Augen auf der Parkbank sitzt.
Der saure, erfrischende Zitronengeschmack auf meiner Zunge erweckt die Geschmacksknospen.
So viele Gelbtöne: Schokobananen auf dem Tisch, die Wolldecke auf der Couch, das Kissen unter dem Laptop, das sich so sanft auf meinem nackten Bauch anfühlt, Zopfkerze auf dem Tresen, Kästchenmuster auf der Blumenvase.
“I want you to do this with me for one month. One month. Write 10 observations a week and by the end of four weeks, you will have an answer. Because when someone writes about the rustic gutter and the water pouring through it onto the muddy grass, the real pours into the room. And it’s thrilling. We’re all enlivened by it. We don’t have to find more than the rustic gutter and the muddy grass and the pouring cold water.” - Marie Howe
Ich höre auf Marie und beschließe, mich der Aufgabe zu stellen. Ende jeder Woche werde ich meine Beobachtungen mit dir teilen. Sie verspricht, dass ich nach einem Monat eine Antwort haben werde. Welche verrät sie nicht. Wir evaluieren. Machst du mit?






Guter Tipp! Nicht nur, um mehr präsent zu sein. Vor allem, um besser zu schreiben. „Show don’t tell” heißt da ja eine Regel. Und wenn man noch einen Schritt weitergehen will (Salman Rushdie empfiehlt das, aber auch viele andere): auf Adjektive verzichten. Dann bleibt nur noch das, was ist. Verrückt.
Bin gespannt auf DEIN Experiment!