





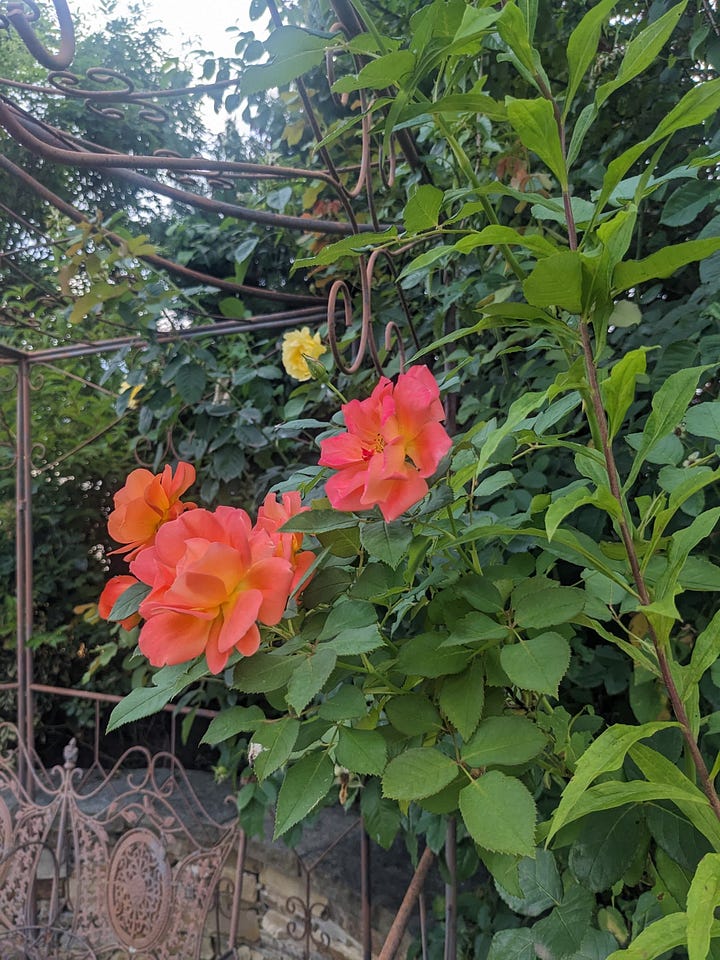

Ich bahnte mir vorsichtig einen Weg durch das dichte Geäst des Blumengartens. Blätter und Zweige schmiegten sich dicht aneinander, sodass ich besonders aufpassen musste, um nicht an den Rosendornen hängen zu bleiben. Unnötig eigentlich, da ich ohnehin nur ein altes weißes T-Shirt trug – nichts also, woran ich emotional hing (an Klamotten sowieso nicht). Die Sonne brach durch das Blätterdach und warf tanzende Schatten auf den heißen Steinboden, während ich versuchte, mich mit der Gartenschere zu den prächtigsten Rosen durchzudrängen. Vorsichtig kniete ich mich vor den Strauch mit den rosa Blumen, nahm die schönste am Stiel und: „Schnipp!“ Beeindruckt und ein wenig erschrocken darüber, wie gut die Schere funktionierte, hielt ich die herrlich duftende Blume in die Höhe: Das wird ein schöner Blumenstrauß!
Über mir spannte sich ein strahlend hellblauer Himmel auf, während sich in der Ferne die Alpen abzeichneten. Ein Moment der Ruhe. Vor ein paar Wochen schrieb ich darüber, wie sehr ich mich nach taktilen Reizen sehnte – etwas mit den Händen machen, aus dem Kopf raus, in den Körper rein. So kam es mir gelegen, dass mich meine Mama bat, zu Hause auszuhelfen, und ich dafür in die Berge fahren „musste“. So packte ich vorgestern meinen kleinen, optimal proportionierten Koffer, den ich vor Jahren als Redakteurin bei den European Games geschenkt bekommen hatte (immer her mit dem free stuff!), und machte mich auf den Weg nach Tirol. An Online-Meetings auf der großen Terrasse mit Bergpanorama-Blick teilnehmen? Yes, please! Beim Kaffeepäuschen auf der Sonnenliege chillen? Her damit. Zumindest so lange, bis einem vor lauter Hitze schwindelig wird und der Schweiß aus allen Poren drückt. Vielleicht ist ja ein Sprung in den 16 Grad kalten Pool (ein echter Bergpool eben) auch drin. Zählt das eigentlich auch als Brat Summer, der die Popkultur gerade dominiert – wenn auch ohne verschmierte Mascara, aber dafür mit einem erdverschmierten, verschwitzten T-Shirt?!


In jungen Jahren konnte für mich nichts die Sehnsucht nach dem Sommer übertreffen. Nicht nur, weil wir in der Schule so lange Ferien hatten und sich das damit einhergehende Freiheitsgefühl endlich entfalten konnte, sondern weil es uns mächtig fühlen ließ. Furchtlos. Die Abenteuerlust, die monatelang davor in mir schlummerte, wurde mit dem Anbruch des Julis plötzlich geweckt, auch wenn ich sie vielleicht in der Realität selten der Fantasie gerecht ausleben konnte. Viel brauchte ich als Kind sowieso nicht. Einfach draußen sein, am Land bei der Oma mit den gleichaltrigen Großcousinen Zeit verbringen. Öfters schlenderten wir mit einer Gruppe von Nachbarskids zum nahegelegenen Fluss, picknickten dort bis zur Abenddämmerung und quatschten über alles und nichts. Abends hingen wir in einem Schulstadion mit den bad boys ab, da, wo meine Oma mich nicht finden konnte. An einem solchen Abend hatte ich ein gelbes, knielanges Blümchenkleid an, die ellenbogenlangen Haare waren von den Zöpfen natürlich gewellt und auf der Nase waren maximal drei Sommersprossen aufgetaucht. Ich fühlte mich hübsch und tauschte mit bad boy 2 ein paar verstohlene Blicke aus. Das war für mich eine Revolution, da ich von Grund auf ein wahnsinnig schüchternes Kind war, aber davon war an dem Abend nichts zu sehen. Ich war wie ausgewechselt und völlig in meinem Element.
Dass der Sommer vor der Tür steht, erkenne ich auch heutzutage an diesem Sehnsuchtsgefühl, das in mir aufkommt: hallo Risiken, ciao Komfortzone! Der Körper reagiert auch automatisch auf diese jahreszeitliche Veränderung, ich schlafe weniger, habe aber trotzdem viel Energie. Vielleicht liegt es an dem bitternötigen Vitamin D-Schub. Die Tage sind länger, und damit wächst auch das Potenzial, die eigene Kreativität zu entfalten und ins Gefühl zu gehen. In der frühen Kindheit fiel es mir, wie wahrscheinlich vielen, leichter, in der Euphorie vollkommen präsent zu sein, während ich heute in den glücklichsten Augenblicken, die nur zu oft wie ein vorbeirauschender Zug vergehen, meistens ein Stückchen Wehmut verspüre. Author Benedict Wells hat dafür ein neues Wort geschaffen: Euphancholie. Der Begriff taucht zum ersten Mal in seinem Bestsellerroman Hard Land vor. Er erklärt diese Wortschöpfung folgendermaßen:
Einerseits ist man fast zerrissen vor Glück, aber auch wehmütig, weil der Moment bald vorbeigehen wird; man vermisst ihn schon jetzt. Generell habe ich es als Jugendlicher oft selbst erlebt, dass man selbst nach schlimmsten Erfahrungen plötzlich in ausgelassenes Gelächter ausbrechen konnte – und umgekehrt. Dieses schnelle, manchmal völlig unlogische Umschlagen der Emotionen hat mich immer fasziniert, alles geschah gleichzeitig.
Das Empfinden des Glücks, gefolgt von der Traurigkeit über seine Vergänglichkeit, habe ich schon als Jugendliche in mir verspürt, aber damals keine Worte dafür gefunden. Eupancholie beschreibt es perfekt. Manchmal stört es mich, dass ich heute dazu neige, auf Situationen von außen zu blicken, denn für mich liegt die eigentliche Bedeutung schöner Momente darin, diese bewusst und aktiv zu erleben. Doch der Switch passiert trotzdem, sei es auf einem Konzert, bei dem ich bis tief in die Nacht hinein tanze, oder während eines ruhigen und lustigen Abends mit Freund:innen. Da taucht er auf, der Moment, in dem man nicht mehr bei sich ist, sondern sich im Außen bewegt. Der Moment, in dem ich nicht mehr bei mir bin, sondern mich im Außen bewege. Als ich den durchgestrichenen Satz vorher aufgeschrieben hatte, musste ich schmunzeln, weil meine Therapeutin mich mal darauf hingewiesen hat, dass ich in Erzählungen selten von mir spreche, sondern meistens das allgemeine man benutze. „Du, du musst du sagen,“ sagte sie lächelnd. „Du kannst und sollst nur von dir sprechen. Und dich nicht hinter dem man verstecken.“
Sie hat schon recht, und vielleicht habe ich auch in der finalen Version dieses Textes an einigen Stellen die allgemeine Man-Form in die Ich-Perspektive korrigiert. Trotzdem finde ich, dass diese Meta-Ebene auch etwas Schönes und Verbindendes hat. Es gibt zum Beispiel diesen einen Moment des stillen Einvernehmens zwischen zwei Personen. Er kann sich durch ein sanftes Grinsen zeigen und ist für beide die Bestätigung, dass sie gerade am selben Punkt ihrer Wahrnehmung angekommen sind. Sie sind sich der Kostbarkeit des gemeinsamen Erlebnisses bewusst und teilen diese Erkenntnis nonverbal miteinander. Dann machen sie weiter wie zuvor, doch was zurückbleibt, ist hoffentlich die Dankbarkeit für das Erlebte.
Solche Augenblicke sind mitunter die schönsten. Der Wunsch ist es natürlich trotzdem, zu lernen, so präsent wie möglich zu sein. Die vierwöchige Beobachtungsaufgabe war schon ein guter Anfang und hat mich ein Stückchen weitergebracht. Keinen blassen Schimmer, ob ich das zu 100% schaffen kann. Wir beobachten das.
Eure Niki






