Das Jahr des Ausprobierens
oder wie ich Woche für Woche in ein anderes Leben schlüpfen durfte
Als ich in meiner letzten Kolumne schrieb, dass das Jahr doch bitte im März statt im Januar beginnen sollte, meinte ich es offenbar ernst. Denn hier war die letzten zwei Monate noch Winterpause. Nicht, weil ich nichts zu sagen gehabt hätte – mit der schieren Anzahl meiner Gedanken hätte ich Bücher füllen können –, sondern weil ich den Jahresanfang mit Dingen verbringen wollte, die weniger Zeit am Schreibtisch erfordern. Das hat dazu geführt, dass sich die Worte zwar in mir angesammelt haben, aber anstatt schriftlich auf Papier verewigt zu werden, wurden sie Woche für Woche in unterschiedlichster Ausprägung und Emotion aus meinem Mund in die Luft geschossen – und verpufften dabei.
Vor zwei Monaten begann ich nämlich einen Schauspielkurs.
Am ersten Kurstag Anfang Februar saßen 15 fremde Menschen unterschiedlichen Alters im Kreis und musterten sich vorsichtig, manche lächelten sich nervös an, andere mieden Augenkontakt, starrten auf den Boden oder ihr Handy, niemand wusste, was passieren würde oder worauf sie sich hier eingelassen haben. Dann sagte jede*r reihum, warum er oder sie hier ist. Wie bei einem AA Meeting, nur ohne Alkoholproblem. Als ich dran war, klopfte mein Herz so schnell und laut wie schon lange nicht mehr. Mein Atem setzte kurz aus, und ich fürchtete, nur stottern und keinen klaren Satz herausbringen zu können. Als wäre ich 13 und nicht 33. Irgendwie schaffte ich es, zu erklären, dass ich als Schreiberin sehr viel Zeit allein mit meinen Gedanken verbringe und etwas tun möchte, bei dem ich meine Gefühle und Emotionen körperlich ausleben kann, statt sie nur aufzuschreiben. „Gut, ja“, sagte die Kursleiterin. Ich sprach ehrlich, auch wenn meine Antwort nur die halbe Wahrheit war. Denn vor allem wollte ich üben, mehr im Moment zu leben und instinktiv zu handeln, statt mich und andere ständig von außen zu beobachten. Gar nicht so einfach, wie ich schnell lernen sollte, wenn man vor fremden Menschen auf Knopfdruck in verschiedenste Lebenssituationen schlüpfen muss.
Die Dozentin erklärte anschließend unser Ziel für die kommenden Monate: Wir würden die Schauspielgrundlagen nach Lee Strasberg lernen, improvisieren und dabei einen Monolog aus einem für jede Person vorgegebenen Theaterstück einstudieren und am Ende des Kurses aufführen. Ich bekam Denise aus Problem Child, Suburban Motel von George F. Walker: eine kratzigbürstige ehemalige Junkie aus einem kaputten Zuhause, der das Sozialamt die kleine Tochter namens Christine weggenommen hat. Denise lebt in einem Motelzimmer mit ihrem Freund, der kürzlich aus dem Knast entlassen worden ist und nun nur mehr vor dem Fernseher hängt. Wochenlang wartet sie darauf, dass Helen, die Sozialarbeiterin, ihr mitteilt, wie es mit ihrer, inzwischen bei Pflegeeltern lebenden, Tochter, weitergeht. Warum die Dozentin ausgerechnet in mir eine Denise sah, habe ich zunächst nicht hinterfragt.
Jeden Montagabend tauchten wir für dreieinhalb Stunden in unsere Rollen ein, mit Techniken, die uns Schritt für Schritt näher an das Innenleben unserer Figuren brachten. Wir wählten ein Tier, das unser Wesen spiegelt (in meinem Fall eine streunende Katze), verfassten Tagebucheinträge, die die tiefsten Geheimnisse unserer Rolle offenbarten, suchten persönliche Objekte aus, die unsere Figur emotional aufladen (für Denise war es ein Kuscheltier ihrer Tochter). Wir dachten über Kleidung und Musikgeschmack nach, überlegten uns ihre morgendliche Routine, führten Interviews, um sie menschlich zu ergründen und gesellschaftlich zu verorten. Wir improvisierten einen privaten Moment, also eine intime Szene, in der die Figur ganz für sich ist; überlegten uns also, was sie tun würde, wenn sie unbeobachtet ist. Das war für mich der wohl stärkste Moment, den ich in diesem Kurs erleben durfte. Instinktiv nahm ich das Kuscheltier und begann, es wie ein echtes Baby zu wiegen, mit ihm zu spielen und zu tanzen. Zum Schluss legte ich mich hin auf den Boden und wiegte nicht nur das Baby, sondern auch mich selbst in den Schlaf. Als mich die Dozentin fragte, wie es mir nach der Szene erging, war ich wieder ganz verschlossen, meine Verletzlichkeit hatte ich in der Szene zugelassen, doch als ich dann darüber reden musste, sagte ich nur noch: „Ich fands ganz süß.“

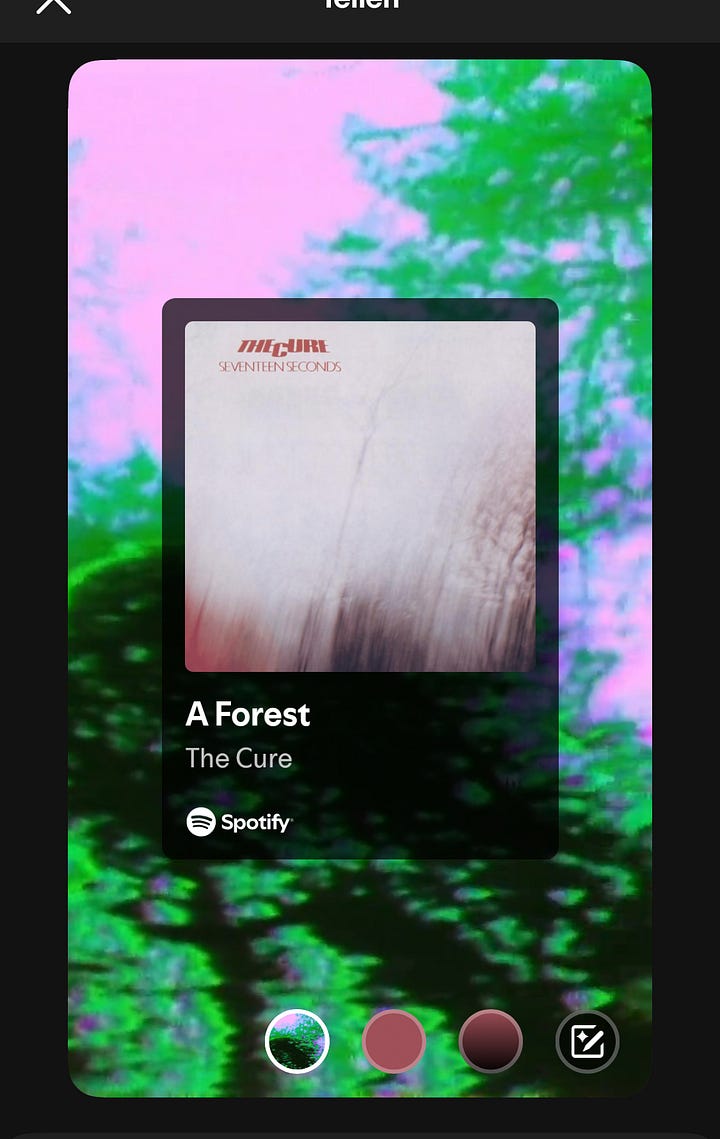
Die letzten Monate waren intensiv, mit der Zeit reduzierte sich die Zahl der Teilnehmenden auf die Hälfte; denn das Commitment ist groß, und nicht jeder kann sein Leben Woche für Woche für mehrere Stunden pausieren, um in ein anderes einzutauchen, zumal es nicht immer ein besseres ist. Für mich ist das Schauspiel ein Ergründen von Empathie. Denn egal, wie schlimm sich Denise verhält (sie begräbt mithilfe eines Motelmitarbeiters Helen lebendig, wobei sich später herausstellt, dass Helen am Ende doch überlebt hat), ich habe sie lieben gelernt. Nach wochenlanger Vorbereitung dürfen wir morgen unseren Monolog in voller Freiheit ausleben und aufführen. Nun sitze ich ich hier, lerne den Text und starre meine Gummistiefel an, die ich morgen bei der Vorführung tragen werde (siehe Mensch begraben und so…) und lasse die letzten Monate Revue passieren. Und weil Listen immer befriedigend sind, habe ich aufgeschrieben, was ich dabei über mich selbst und zwischenmenschliche Dynamiken gelernt habe:
Schauspiel macht dich empathischer.
Denn auch wenn Denise mehr als nur streckenweise unsympathisch ist (lebendig begraben – hallo?), muss ich das Menschliche in ihr finden, um sie spielen zu können. Es reicht nicht, sie zu tolerieren – ich muss fühlen, was sie fühlt, muss begreifen, warum sie sich so verhält. Mehr als einmal ertappte ich mich dabei, sie zu verteidigen, wenn andere ihr Verhalten – verständlicherweise – ablehnen. Sie kann ohne ihre Tochter weder schlafen noch essen, um jeden Preis will sie ihr Kind zurück. Sie ist verzweifelt, von Familie und Gesellschaft verstoßen. Nichts gehört ihr, und das, was ihr gehört, wurde ihr genommen. Wir verurteilen oft schnell, aber weiß überhaupt jemand, wie wir selbst reagieren würden, wenn alles auseinanderfällt?
Schauspiel macht mich zu einer besseren Schreiberin.
Jeden Montagabend mache ich Urlaub von mir selbst, lege Niki ab und betrete die Welt einer anderen. Das hilft mir, komplexere Figuren zu schreiben, bessere Fragen zu stellen und tiefere Antworten zu finden. Schauspiel und Schreiben sind beides nuancierte Akte, bei denen das Ungesagte, also das, was sich in Blicken, Pausen und Untertönen verbirgt, spannender und wahrhaftiger ist als das Gesagte. Oft glauben wir, dass Worte unser wichtigstes Werkzeug ist, dabei haben wir Zugang zu so viel mehr, wenn wir diese Kanäle öffnen.
Wenn du dich selbst ablegst, begegnest du dir selbst umso mehr.
Du lernst deine Triggerpunkte kennen, deine Grenzen, deine Stärken und Schutzmechanismen. Manchmal überrascht dich, was du emotional abrufen kannst und was dich blockiert. Manchmal erscheint dir die Dozentin unfair, zu kritisch; ein andermal erlebst du sie als hilfsbereit und großzügig. Nach dem Unterricht fühlst du dich mitunter beflügelt und beseelt, ein anderes Mal ausgelaugt und genervt. Dein Selbstbild entspricht nicht immer dem Fremdbild – wie du auf andere wirkst, ist oft weit entfernt von dem, was du in dem Moment tatsächlich gefühlt hast. Im schlimmsten Fall kann das sehr frustrierend sein, im besten Fall befreiend, weil du erkennst, dass du es nie allen recht machen wirst und immer ein Stück weit missverstanden wirst. Dabei lernst du, diesen Raum zwischen Innen- und Außenwahrnehmung zu navigieren. Manchmal gelingt dir das gut, manchmal weniger.
Es gibt im Schauspiel keinen „Zustand“.
Alles ist innerer Konflikt. Auch Freude. Auch wenn eine Figur still ist und lautlos sitzt, passiert in ihr etwas. Diesen Konflikt braucht es auf der Bühne, ansonsten wird’s langweilig. Das ist wohl das, was Schauspiel vom echten Leben entscheidet, dachte ich. Denn dieses ist für mich voller Zustände.
Verletzlichkeit zuzulassen erfordert Stärke,
besonders, wenn du dich, im übertragenen Sinne (in unserem Kurs zumindest) nackt vor anderen zeigst. Doch es wird Woche für Woche leichter, auch, weil die anderen im selben Boot sitzen. Denn alles, was geteilt wird und nicht allein gemeistert oder ausgehalten werden muss, verliert ein Stück seines Schreckens und fühlt sich weniger einsam an. Wenn du Glück hast, entsteht dabei sogar eine Verbindung, manchmal nur für einen Moment, manchmal auf ewig.
Du weißt nie, was andere Menschen durchmachen.
Wenn es kein offenes Gespräch gibt, in dem Menschen frei kommunizieren können und wollen, wie sie sich fühlen, und wenn du nicht in der Lage bist, deine eigenen Gedanken zu hinterfragen, sondern sie ungefiltert für die Wahrheit hältst, dann ist alles, was du dir denkst, letztlich nur Annahme und Interpretation. Wenn du dir dessen bewusst bist, inspiriert es dich hoffentlich dazu, anderen so urteilsfrei wie möglich zu begegnen.
Du musst dir selbst erlauben, Raum einzunehmen.
Ich habe bemerkt, dass ich dazu neige, die Übungen sehr schnell abzuschließen, viel zu schnell zu sprechen und mir kaum Pausen zwischen den Sätzen zu gönnen, aus dem Gefühl heraus, anderen Zeit und Raum wegzunehmen. Dabei gibt es Menschen in unserem Kurs, die damit überhaupt nicht zu kämpfen haben – im Gegenteil. Selbst auf der Bühne wird dir der Raum nicht geschenkt, du musst ihn dir nehmen, manchmal sogar einfordern. Aber vor allem musst du dir selbst das Vertrauen schenken, dass du es wert bist, ihn zu füllen.





Vor allem habe ich aber in den letzten Wochen gemerkt, wie sehr mir das Schreiben gefehlt hat und dass ich es brauche, um mich ganz zu fühlen. Ich möchte wieder in Echtzeit von meinen Erkenntnissen erzählen, statt erst dann zu berichten, wenn alles verarbeitet und überstanden ist, wenn ich bereits „über den Berg“ bin sozusagen und mich in einem Zustand statt in einem Konflikt befinde. Das hier ist wohl meine Art, euch zu sagen, dass ich euch vermisst habe und dass die Kolumne wieder zum Leben erwacht.
Until next week. Danke an alle, die geblieben sind.
Eure Niki






Wow, super spannend. Danke für den Tiefblick! *googelt "schauspielkurse in der nähe"*